Co-Planning im Referendariat als Blaupause für die spätere Zusammenarbeit in der Schule
…und jede Schule plant für sich allein - so lautet der Titel eines Blogeintrags von Catrin, in dem sie die Konzeption eines pädagogischen Tages zu KI teilt. Dieser Satz ließe sich auch auf die Konzeption von Unterricht beziehen, die in der Ausbildung und danach noch viel zu oft in der Hand einzelner liegt. Unterrichten ist unser Kerngeschäft, doch wie oft denken wir gemeinsam laut darüber nach - mit Zeit, mit Muße, in die Tiefe arbeitend und nicht nur flugs zwischen Tür und Angel Materialien teilend? Letzteres funktioniert schon vielerorts gut - arbeitsteilig Unterricht planen ist zeitsparend und effizient. In diesem Blogbeitrag möchten wir aber eine Lanze brechen für die ko-konstruktive Planung von Unterricht: Sie ergibt mehr als die Summe ihrer Teile und bereichert im besten Fall die Lernenden (und uns), weil sie zu mehr Unterrichtsqualität führt. Mit diesen Gedanken haben wir uns vor einigen Jahren auf den Weg gemacht, im Rahmen der Lehrkräfteausbildung Unterrichtshospitationen im Co-Planning-Verfahren zu bestreiten. Wie wir das machen (oder gemacht haben in Iris’ Fall), davon berichten wir hier.
Spannungsfeld: Zusammenarbeit
Alltagserfahrungen von Lehrer:innen im Bereich der Zusammenarbeit sind unterschiedlich. So kann Kooperation als Last oder Entlastung empfunden werden. Einflussfaktoren sind die Schulorganisation, Gruppenprozesse im Kollegium und die richtige Balance zwischen Kooperation und Autonomie. Besonders bemerkenswert in diesem Kontext ist, dass Lehramtsstudierende schon während des Studiums hinsichtlich der Öffnung von Unterricht für kollegiale Einblicke Vorbehalte hegen (Befunde zusammengestellt aus Friedrich Jahresheft Kollaboration 2018).
Wir haben uns nun gefragt, welchen Beitrag wir leisten können, um Zusammenarbeit zu fördern, auch vor dem Hintergrund, dass LAA mit der Rolle als Multiplikator:in in Schulen zurecht überfordert sind. Wir möchten in erster Linie für Zusammenarbeit sensibilisieren und LAA die Möglichkeit geben, Kollaboration und dazugehörige Formen aktiv zu erleben und auszuprobieren.
Als Grundlage dafür haben wir zehn Thesen zur Kollaboration im Fachseminar erstellt, die die Wichtigkeit, Chancen und Herausforderungen von Kollaboration zusammenfassen:
Wer Kollaboration im Fachseminar fördern will, muss Vorbild auf Augenhöhe sein: Ich als Fachleitung teile meine unperfekten Materialien und stelle auch Fragen etc.
Kollaboration im Fachseminar ist nicht das Endprodukt - vielmehr steht sie für einen fortlaufenden Prozess. Im Mittelpunkt steht der Weg, nicht das abschließende Ergebnis. Die gemeinsame Arbeit, die Dynamik und das Miteinander sind das eigentliche Ziel. Entscheidend ist dabei auch die Reflexion darüber, ob ich mit dem Ergebnis zufrieden bin - und offen bleibe für neue Perspektiven und Veränderungen, die aus der Zusammenarbeit entstehen können.
Kollaboration im Fachseminar spricht alle an der Ausbildung Beteiligten an und wirkt so auch dem Mythentransport entgegen.
Kollaboration im Fachseminar muss arbeitsentlastend sein. Das meint beispielsweise das Arbeiten im eigenen Tempo und in geteilter Verantwortung sowie die Erkenntnis, nicht alles kontrollieren und übernehmen zu müssen.
Kollaboration im Fachseminar kann synchron, asynchron, analog und digital geschehen.
Kollaboration im Fachseminar stellt hohe Anforderungen und muss eingeübt werden. Dabei ist eine Hürde zu überwinden: Unperfektes teilen und klären, was erlaubt ist, so dass sich andere mit ihren Gedanken einflechten, hineinschreiben usw.
Kollaboration im Fachseminar schafft Reflexionsmöglichkeiten (und muss reflektiert werden). Die Art der Kollaboration kann so im Prozess angepasst oder verändert werden, denn ihre Eckpunkte sind nicht statisch und ändern sich je nach den Bedingungen und Menschen.
Kollaboration im Fachseminar schafft Multiperspektivität - und macht mich dadurch noch sprechfähiger, selbst wenn ich bei meiner Schwerpunktsetzung bleibe.
Kollaboration im Fachseminar muss systemisch gefördert werden: Auf allen Ebenen, um über individuelle Initiativen hinaus die gesamte Schul- und Seminarkultur zu prägen. Dieser Punkt muss unbedingt mit den Thesen 3 und 5 zusammen gedacht werden.
Kollaboration im Fachseminar schafft Möglichkeitsräume: Mal schaue ich zu, mal kicke ich mit - und das fühlt sich gut an, Verantwortung auch mal abzugeben und an anderen Stellen andere wieder mitzureißen.
Kollaboration im Fachseminar kann in unterschiedlichen Formen und zu unterschiedlichen Zeitpunkten sinnvoll sein, zum Beispiel in Fachseminarsitzungen und bei ihrer Vor- und Nachbereitung. Diese Art der Zusammenarbeit ist mehr oder minder etabliert.
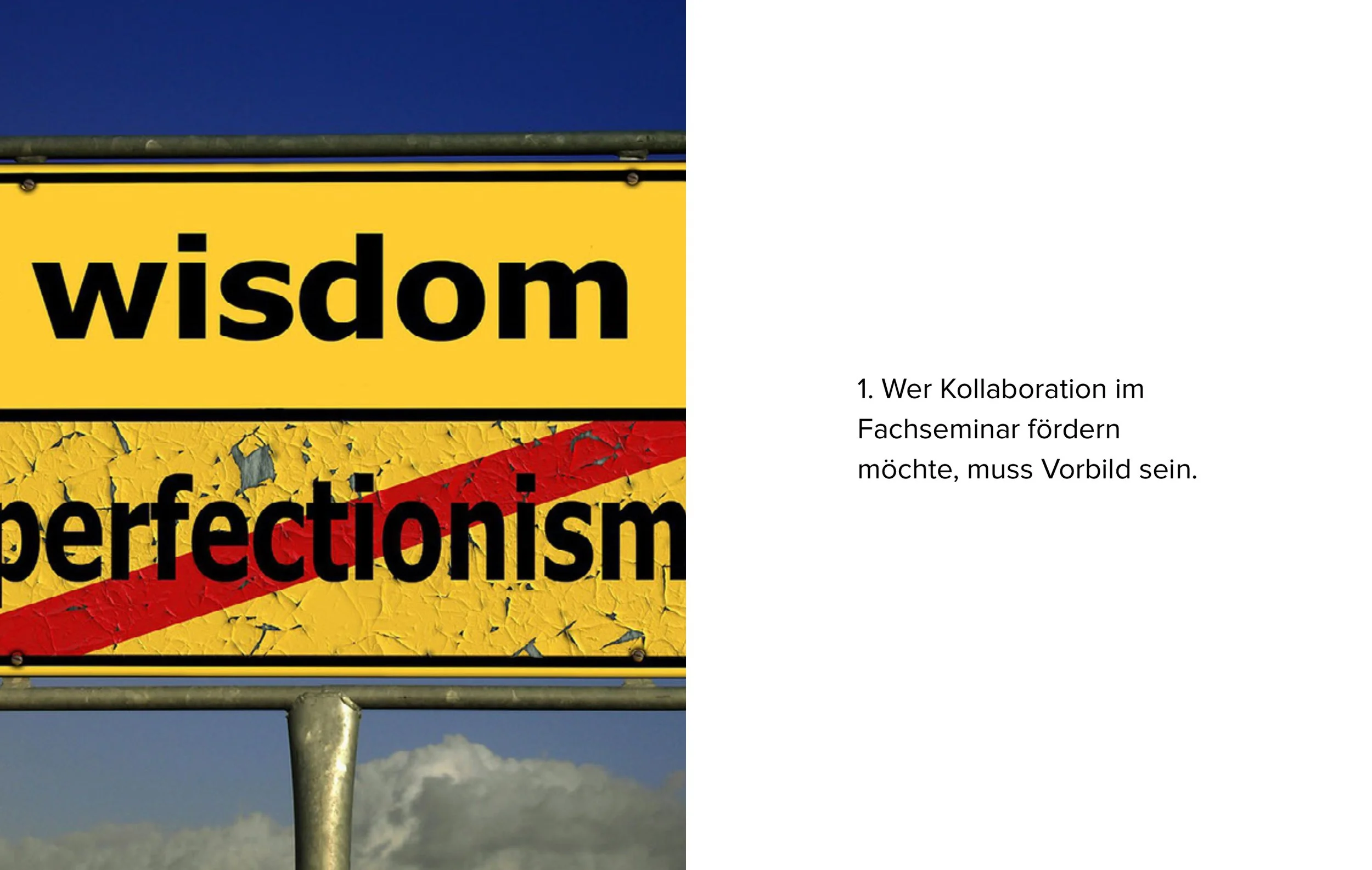
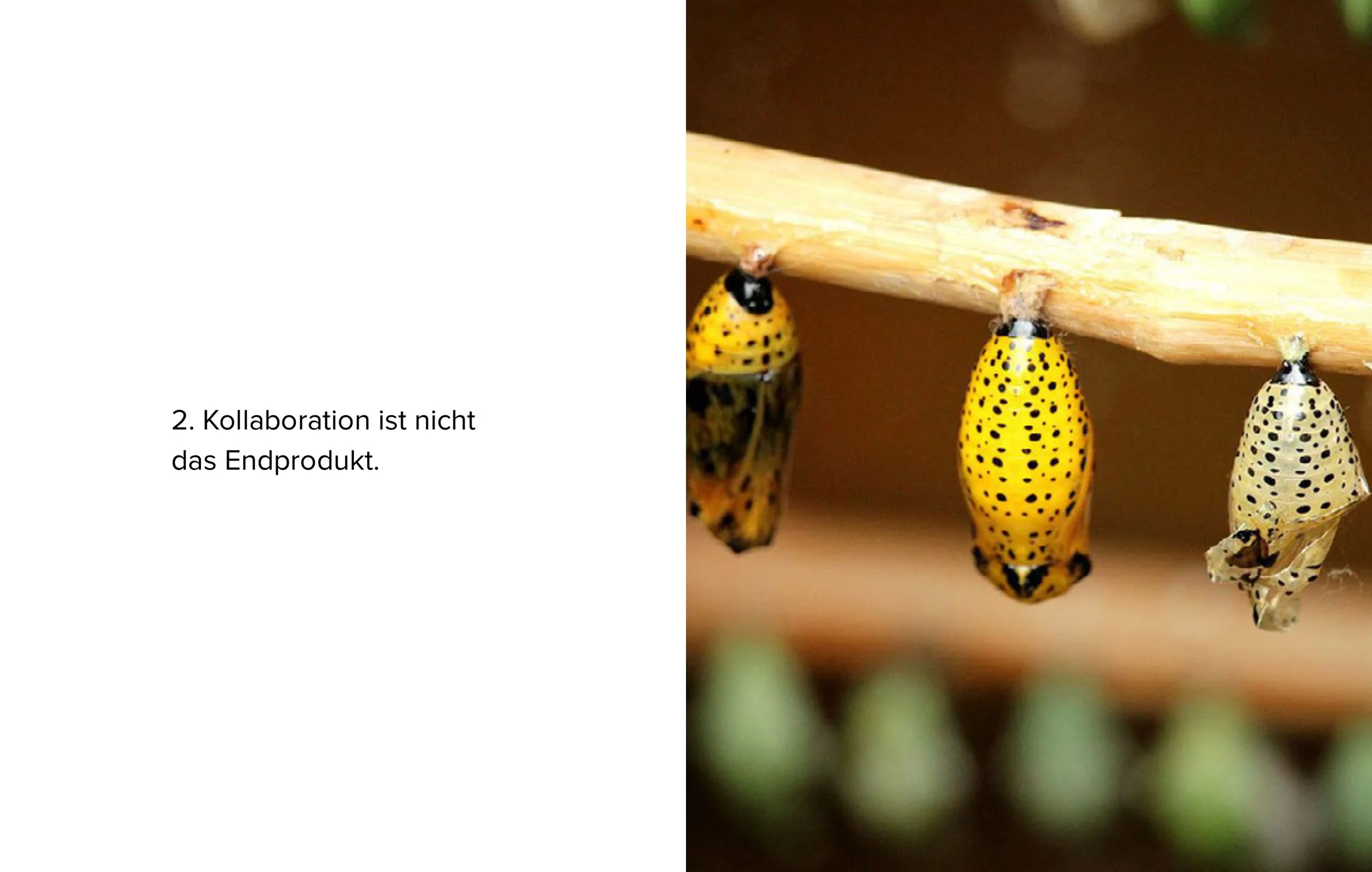

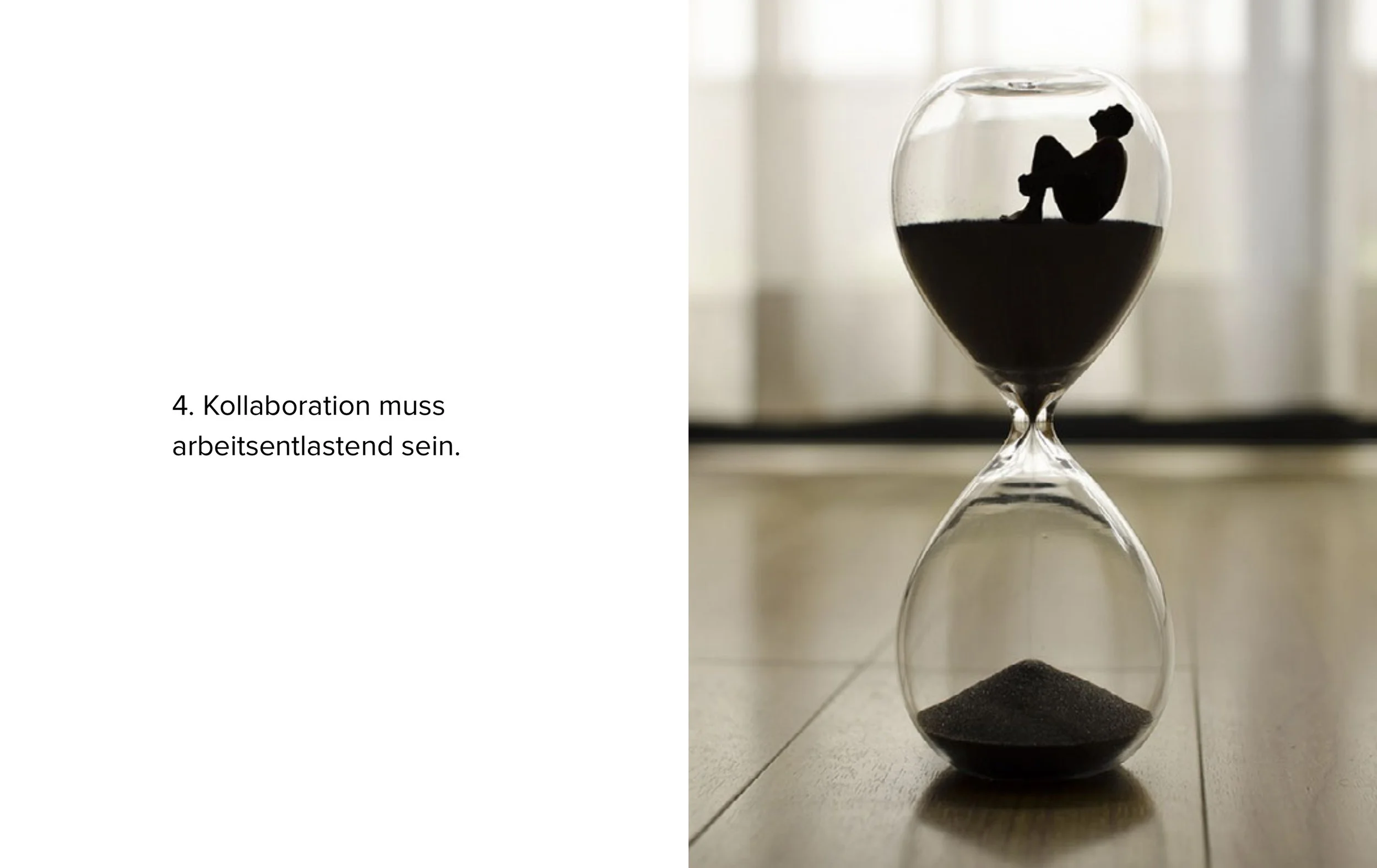
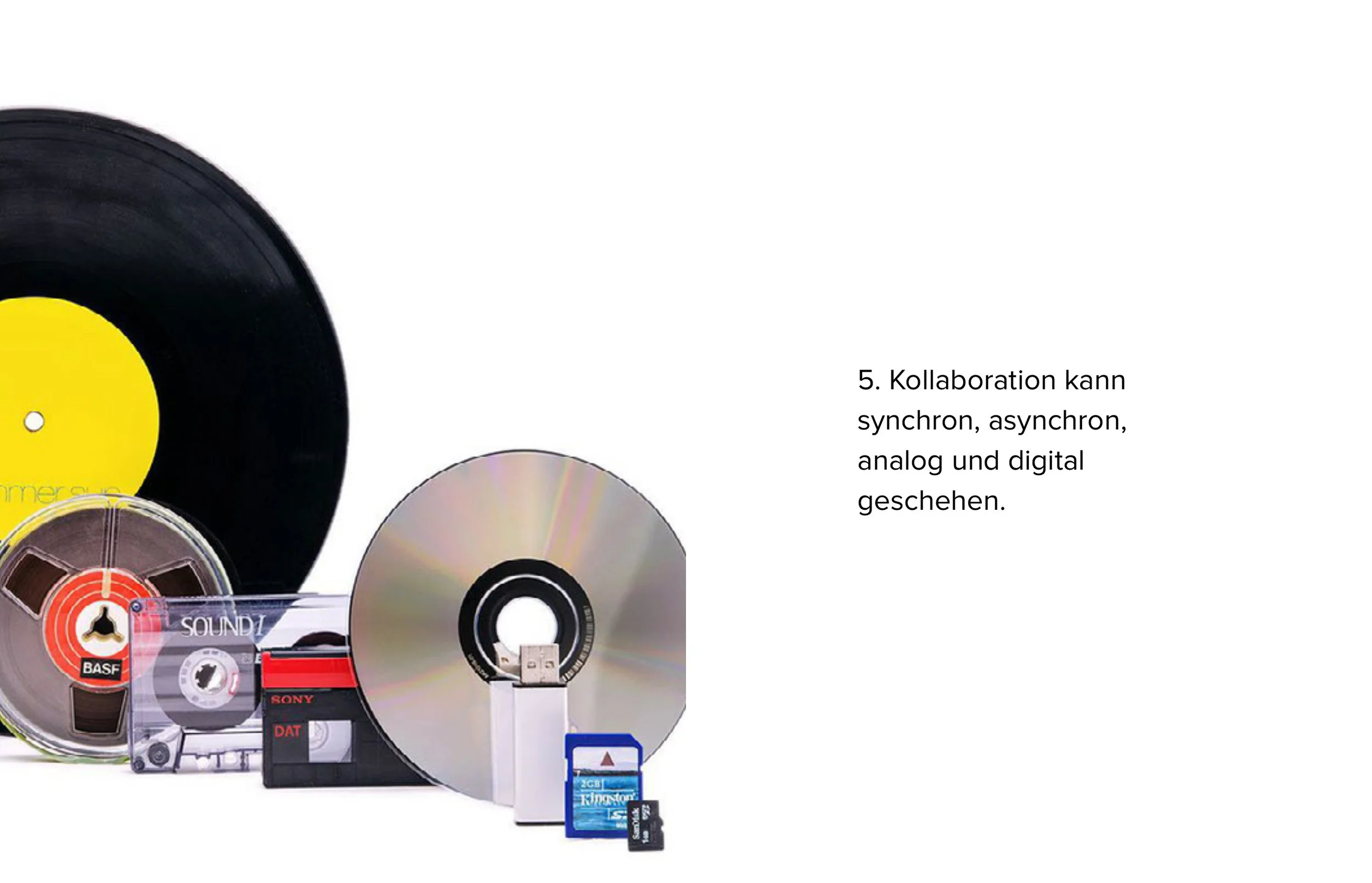

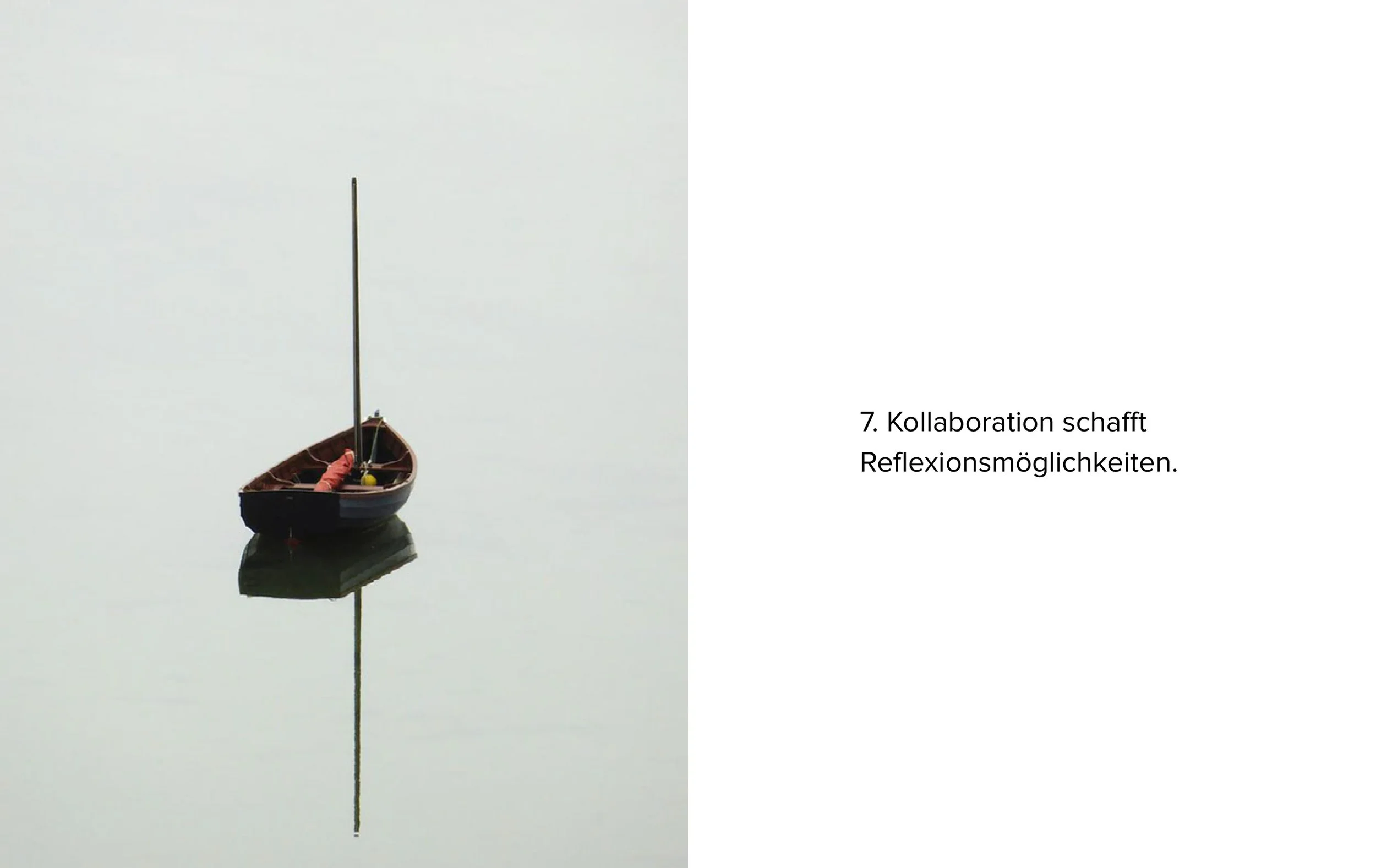
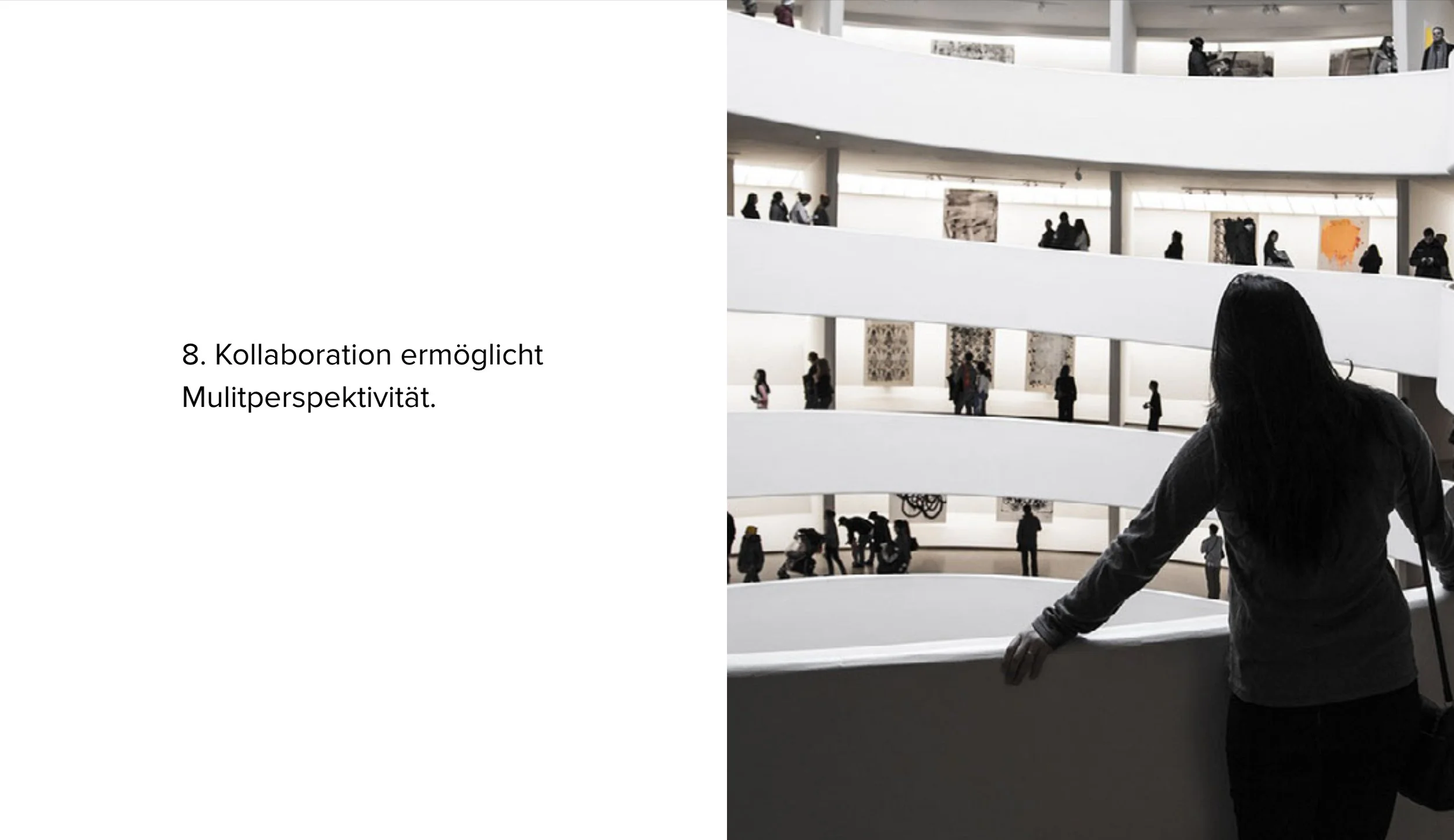
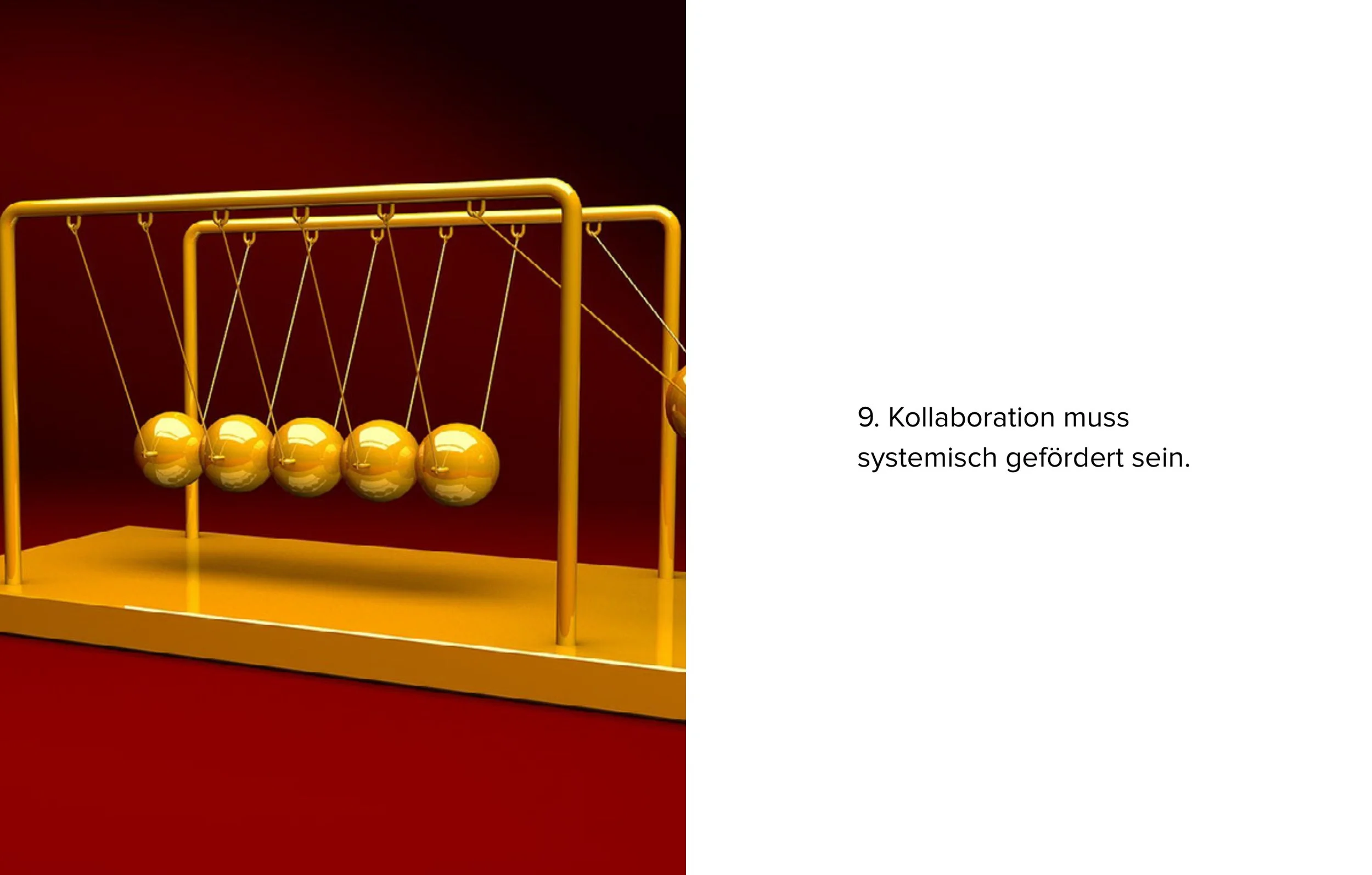
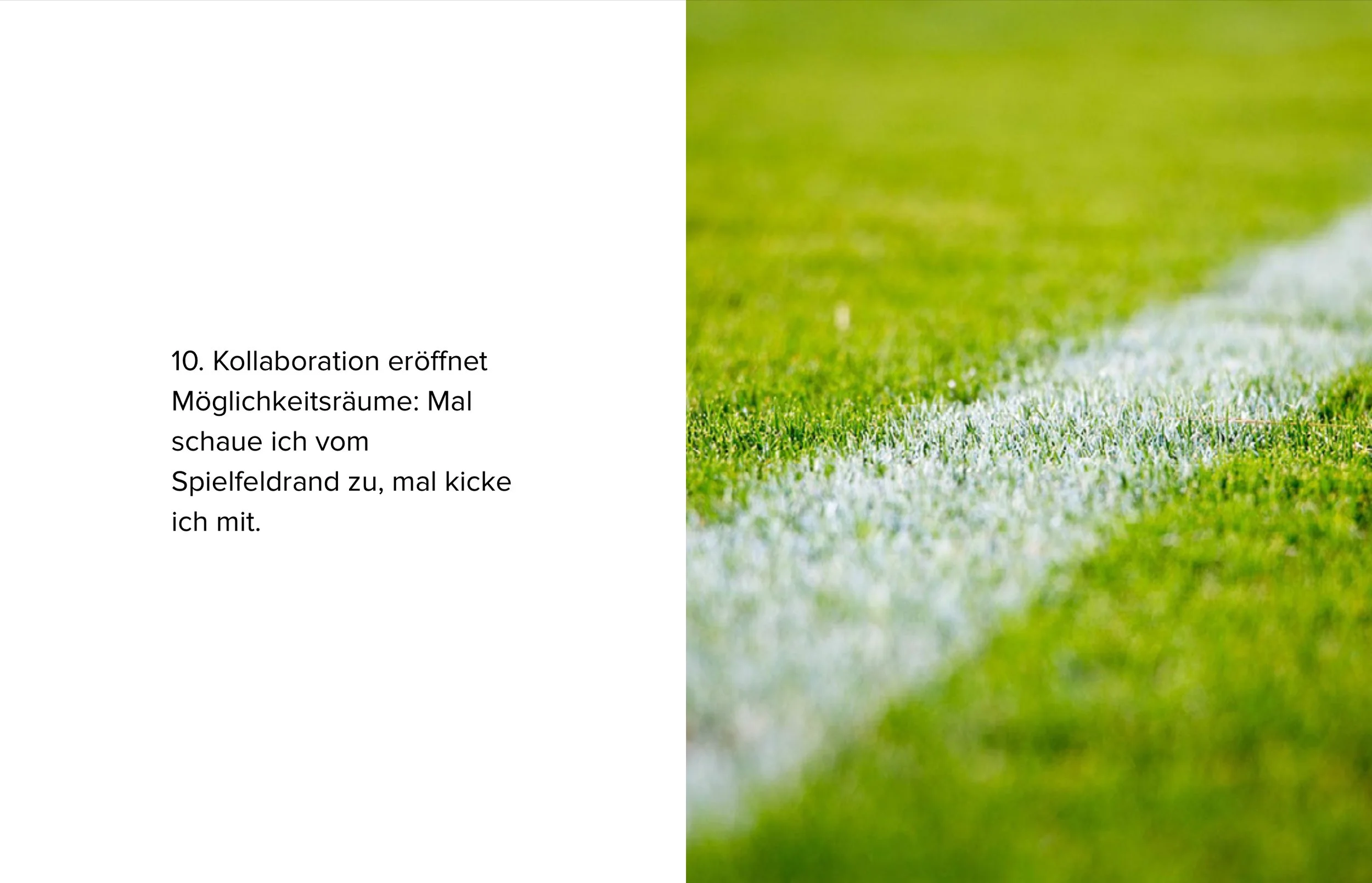
Was ist Co-Planning und warum ist es uns wichtig?
Wir richten unser Augenmerk auf die ko-konstruktive Unterrichtsplanung mehrerer Personen zur Vorbereitung eines Unterrichtsbesuchs: Die Fachleitung, die / der durchführende LAA, ein Peer und ggf. die Ausbildungslehrkraft gehen gemeinsam an die Planung einer Unterrichtsstunde. So verstanden beschreibt Co-Planning den kollaborativen und transparenten Prozess der Unterrichtsplanung, der dadurch gekennzeichnet ist, dass Planung von Anfang an vollständig offengelegt wird.
Co-Planning erfüllt in einer bedarfsorientierten Ausbildung mehrere wichtige Funktionen. Vor allem aber kann es die traditionellen Expert:in-Noviz:in-Strukturen aufbrechen. Es führt zu einem höheren Lernzuwachs in Vorbesprechungen als in Nachbesprechungen. Durch ein Mehraugenprinzip wird der Prozess offener für Themen und Perspektiven und generiert fast automatisch Alternativentscheidungen. Zudem ermöglicht Co-Planning das Gespräch, manchmal sogar das gemeinsame laute Nachdenken aller an Ausbildung Beteiligten und auf diese Weise das Aushandeln eines gemeinsamen Verständnisses von gutem Unterricht. So lassen sich Mythen rund um den „Albtraum Unterrichtsbesuch“ oder das „Schreckgespenst Fachleitung“ entkräften und der Ausbildungsprozess wird transparenter und vertrauensvoller. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass all diese Punkte dazu führen, dass LAA sich mehr zutrauen, sich mehr trauen und gezielt Dinge ausprobieren, zu denen sie Rückmeldung erhalten möchten und die sie allein so noch nicht stemmen wollen würden. LAA aller Durchgänge geben übrigens zusätzlich an, Co-Planning fühle sich für sie wie eine spürbare Entlastung an und trage maßgeblich dazu bei, den empfundenen Druck vor und während des Unterrichtsbesuchs zu reduzieren.
Wie setzen wir Co-Planning um?
Mittlerweile ist Catrin mit ihren LAA im vierten Durchgang des Co-Plannings angekommen. Wir haben haben beide mitten in einem Jahrgang damit begonnen, Iris ist nach drei Durchgängen an die Schule gewechselt und initiiert nun dort in den Fachschaften die gemeinsame Unterrichtsarbeit.
Unserer Vorgehensweise ist gemein, dass wir beide Co-Planning digital und asynchron durchführen - das gibt uns die größte Flexibilität und den größten Raum. Die Tools, die wir nutzen, sind unterschiedlich. Iris nutzt ein großes Miroboard, in dem als Prozessboard zu Beginn eines Jahrgangs einzelne Kacheln / Arbeitsoberflächen für jeden UB-Durchgang angelegt sind. Innerhalb dieser Kacheln (UB 1, UB 2, UB 3…) legt jede:r LAA für den UB eine eigene Kachel / Arbeitsoberfläche an, auf der alle relevanten Materialien abgelegt werden und über deren Kommentarfunktion der/die LAA mit dem Planungsteam ins Gespräch kommt. Möglich ist natürlich auch, sich analog oder digital synchron zu besprechen, falls die Zeit es zulässt. Alle LAA arbeiten parallel auf einem Miroboard, das von allen eingesehen werden kann. Jede:r kann sich so inspirieren lassen, Materialien sind für alle zugänglich und müssen nicht doppelt und dreifach erstellt werden. Catrins Vorgehen funktioniert ähnlich auf TaskCards - noch geschmeidiger sicherlich, wenn irgendwann endlich Pushfunktion und Sprachmemos als Bordmittel dort bereitständen.
Co-Planning und Bewertung von Unterrichtsbesuchen
Eine der häufigsten Fragen, die wir gestellt bekommen, wenn wir unser Co-Planning-Konzept vorstellen, ist die Frage nach der Bewertung. In NRW werden Unterrichtsbesuche nicht mit einer Einzelnote bewertet, auch wenn die Praxis des “Wenn es ein Examen wäre, dann würde ich Note x geben” das suggeriert. Vielmehr bewerten wir die Leistungen im gesamten Ausbildungszeitraum in den verschiedenen Handlungsfeldern des Lehrkräfteberufs. In die Planung von Unterricht erhalten wir durch das Co-Planning viel mehr Einblick als zuvor: Warum der / die LAA welche Planungsentscheidungen trifft, muss von ihr / ihm in der Nachbesprechung nicht mehr mühevoll rekonstruiert werden, sondern zeigt sich im Prozess. Auf diese Weise können wir übrigens auch viel zielgerichteter unterstützen und uns ein Bild davon machen, wie selbständig schon geplant wird.
Ausblick und Perspektiven
Wir denken weiter: Vorstellbar wäre ein fachseminarübergreifendes Co-Planning, das durch eine multiperspektivische Sichtweise bereichert wird. Die in der OVP vorgesehenen selbstorganisierten Lerngruppen stärken Eigenverantwortlichkeit und nachhaltiges Lernen. Sie fördern kooperatives Arbeiten und Reflexion, was gut mit kollaborativer Planung und Gestaltung von Unterricht verbunden werden kann. Die Verzahnung von Co-Planning und selbstorganisierten Lerngruppen schafft eine lernförderliche, dialogische Atmosphäre und unterstützt die Professionalisierung der LAA. So würde zusätzlich fachübergreifend und praxisnah gemeinsam Unterricht entwickelt werden. Zu dieser Perspektive passt auch, dass Catrins Seminar in NRW eine länderübergreifende Anfrage von Thomas Linke aus dem Studienseminar Bernau in Brandenburg erhalten hat. Eine solche Zusammenarbeit bietet eine vielversprechende Gelegenheit, innovative Ansätze wie das fachseminarübergreifende Co-Planning und die selbstorganisierten Lerngruppen praxisnah zu erproben und weiterzuentwickeln.
Auch das KMK-Ergänzungspapier „Aufgaben- und Anforderungsprofil für Fachleitungen an den Studienseminaren oder vergleichbaren Einrichtungen“ vom 17.09.2025 liefert wertvolle Impulse, um Perspektiven für das Co-Planning zu eröffnen und dessen Weiterentwicklung und Implementierung gezielt anzustoßen. Das Papier betont das Innovationspotenzial der Fachleitungen als Schlüsselfaktor für die Weiterentwicklung der Lehrkräfteausbildung. Im Aufgabenprofil wird unter „Weiterentwickeln und Innovieren“ hervorgehoben, dass Fachleitungen innovative Ansätze eigenverantwortlich in die Ausbildung einbringen und aktiv zur Qualitätssicherung und zur Qualitätsentwicklung beitragen. Das Anforderungsprofil unterstreicht dies insbesondere in den Kompetenzbereichen „Ausbildungskompetenz“, die praxisnahe, zielgruppengerechte und kompetenzfördernde Ausbildungskontexte gestalten soll, sowie „Reflexionskompetenz“, die Fachleitungen befähigt, ihr eigenes Handeln kontinuierlich zu analysieren und weiterzuentwickeln. Für das Co-Planning könnte das bedeuten, dass Fachleitungen ihre Innovations- und Reflexionskompetenzen gezielt einsetzen können, um kooperative Planungsprozesse zu fördern und weiterzuentwickeln. Dabei sind die Integration innovativer Methoden, digitaler Werkzeuge sowie regelmäßiger Reflexions- und Feedbackschleifen zentral, um die Ausbildungsqualität flexibel an aktuelle Herausforderungen anzupassen. Insgesamt unterstützt das Profil somit eine lebendige, lernförderliche Zusammenarbeit zwischen Fachleitungen, Mentor:innen und Lehramtsanwärter:innen, die den kontinuierlichen Wandel und die Qualitätsentwicklung der Lehrkräfteausbildung vorantreibt.
Und hinsichtlich der Übertragbarkeit auf das System Schule? Kollaboratives Arbeiten im Fachseminar und Co-Planning im Ausbildungskontext könnten Modell stehen für schulische Zusammenarbeit. Die im Fachseminar erprobten Ansätze machen deutlich, wie durch Transparenz, Multiperspektivität und geteilte Verantwortung nicht nur die Qualität steigt, sondern auch Beziehungen im Kollegium gestärkt werden. Zur Zusammenarbeit ermutigen, Zusammenarbeit strukturieren und sie nachhaltig zu leben, ist Teil von Schul- und Unterrichtsentwicklung. Prozesse offen zu gestalten, verschiedene Rollen einzubinden, Digitales und Analoges sowie Synchrones und Asynchrones bewusst zu initiieren und systemisch zu unterstützen, bedeutet, Kollaboration als kontinuierlichen Lernprozess zu verstehen, der über individuelle Initiativen hinausgeht und die gesamte Schulkultur prägt. Eine Kultur, zu der Unperfektes und Möglichkeitsräume ebenso gehören wie das Aufbrechen traditioneller Hierarchien.
Weiterführendes und Material:
Digitaler Unterrichtsentwurf: Sinn und Unsinn des digitalen Entwurfs - ein (ehemaliger) LAA aus Catrins Seminar erzählt in diesem Video über Chancen und Grenzen. Seinen digitalen Unterrichtsentwurf könnt hier über diesen Link einsehen.
Im Frühjahr 2022 haben wir zusammen mit der Fachleiterin Anna Reuter und allen Anwesenden auf dem Barcamp vom Institut für zeitgemäße Prüfungskultur über diese Frage nachgedacht: Was müssen Seminarausbild:innen wissen, wollen und können, um zu zeitgemäßer Lehrer:innenausbildung beizutragen? Die Ergebnisse des kollaborativen Austauschs findet ihr hier auf dem Miro-Board.
Iris hat im April 2022 zusammen mit Helene Pachale und Steve Kenner in dem Podcast „Freiräume gestalten - der Bildungspodcast" über Vernetzung und Zusammenarbeit zwischen Lehrkräften, LAA und Seminarausbilder:innen gesprochen und darüber, welche Möglichkeit der Unterstützung hierbei das #twitterlehrerzimmer geboten hat - es fehlt uns übrigens sehr.
Im Sommer 2022 haben wir mit Martin Fritze in dem Edutalk-Podcast zum Thema „Lehrkräfte zeitgemäß ausbilden“ über die Nutzung von Freiräumen und Bedarfsorientierung, zeitgemäße Lern- und Prüfungskultur, Prozessorientierung und eben auch über Co-Planning und Kollaboration gesprochen. An der Aktualität hat sich nichts geändert. Hört gerne rein: https://youtu.be/Ydm-IAulGtQ
